Berufliche Bildung als Schlüssel zur ökologischen Transformation
Ökologische Transformation bedeutet Veränderung. Sie erfordert nicht nur Wissen, Technik und Konzepte, sondern auch manuelle Arbeit. Regionen, die diese Arbeitskräfte mit den passenden Qualifikationen bereitstellen können, weisen relative Wettbewerbsvorteile auf. So kommt der beruflichen Bildung eine Schlüsselrolle zu, denn es gilt die sich ändernden Anforderungen aufgrund der ökologischen und digitalen Transformation zu adressieren und für handwerkliche und technische Berufe zu begeistern.
Die Wirtschaftsstruktur der Emscher-Lippe-Region wurde über Generationen durch die Gewinnung und Verarbeitung fossiler Energieträger geprägt. Aufgrund des Strukturwandels verfügt die Region über Arbeitskräftepotenziale, welche die regionalen Partner:innen im Zukunftscampus und in verbundenen Projekten entwickeln.
Die ökologische Wende braucht Arbeit
Forschung und Entwicklung sind entscheidend für das Gelingen der ökologischen Wende. Doch technischer Fortschritt sowie eine ökoeffiziente Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsweise müssen vor Ort umgesetzt werden, was eine regionale materielle Umstellung erfordert.
Strukturpolitische Interventionen, städtische Wirtschaftspolitik und eine chancenorientierte Bildungspolitik führten in der Vergangenheit allerdings dazu, dass die Entwicklung wissensintensiver Dienstleistungen auf die Agenda gesetzt wurde. Zudem wurde in vielen Regionen stark in die akademische Bildungsinfrastruktur und weniger in die berufliche Bildung investiert.
Mögliche Vorteile einer urbanen Produktion
Wenn städtische Standorte im globalen Norden sich auf Wissensgenerierung und Konsum konzentrieren und umweltschädliche Produktion in die Peripherie oder den globalen Süden verlagert wird, verschlechtert dies allerdings die globale Umweltbilanz. Sogenannte „environmental burden“ werden ausgelagert.
Dem gegenüber wird der Integration von Produktion und Konsum – auch bekannt als urbane Produktion – eine positive ökologische Wirkung nachgesagt. Zum Beispiel könnten Wege zwischen Wohn- und Arbeitsort verkürzt, Ressourcen durch lokale Reparatur- und Kreislaufwirtschaft geschont, regionale Naturressourcen genutzt und die Wertschöpfungsketten regionalisiert werden. Um diese Vorteile, die wissenschaftlich noch zu überprüfen sind, zu realisieren, muss tatsächlich vor Ort produziert und gearbeitet werden. Dafür sind Flächen, entsprechende Infrastruktur sowie qualifizierte, tatkräftige Menschen notwendig, die Hand anlegen.
Ansätze scheitern noch am teuren Faktor Arbeit
Der ökologische Umbau der privaten und öffentlichen Infrastruktur benötigt nicht nur Personen die Wärmepumpen installieren und Solarzellen montieren. Auch Industrieberufe rücken in den Fokus, wenn es gilt, weiter lokal und nachhaltig, zu produzieren.
Viele ökologisch sinnvolle Ansätze scheitern gegenwärtig noch daran, dass Arbeit im Vergleich zu Energie und natürlichen Ressourcen zu teuer ist. Besonders die Ertüchtigung von Gebäuden und Anlagen sowie Tätigkeiten in der Kreislaufwirtschaft benötigen viel manuelle Arbeit.
Daher muss einerseits in die berufliche Bildung investiert werden, um Menschen für manuelle Tätigkeiten auszubilden und zu begeistern. Andererseits sollten Lösungen gefunden werden, wie gerade die einfacheren, manuellen Tätigkeiten, die in Deutschland zwar nicht ökonomisch aber wohl ökologische sinnvoll sind, fair bezahlt und finanziert werden können.
Die Emscher-Lippe Region hat (potenziell) Arbeit
Für die ökologische Transformation bietet das Ruhrgebiet und besonders die Emscher-Lippe-Region (ELR), zu der Bottrop, Gelsenkirchen und der Kreis Recklinghausen gehören, eine besondere Ausgangslage. Die Region hat einen hohen Anteil junger Menschen, die in den nächsten Jahren voraussichtlich in Ausbildung und Arbeit kommen.
Gleichzeitig weist die Region eine überdurchschnittliche Arbeitslosenquote (15,3 %, NRW: 7,5 %) sowie Jugendarbeitslosenquote (7,9 %, NRW: 6 %) auf. Zudem gilt es die große Anzahl künftiger Ruheständler:innen zu ersetzen.
Traditionell sind in der Emscher-Lippe-Region viele Menschen in energieintensiven Industrien beschäftigt: Etwa am Chemiepark Marl oder am Kraftwerkstandort Gelsenkirchen Scholven, die gegenwärtig noch überwiegend fossil produzieren und sich transformieren.
Ausbildungen in der Region
In den energieintensiven Industrien und fertigungstechnischen Berufen wird in den letzten Jahren tendenziell weniger ausgebildet. In anderen transformationsrelevanten Branchen, wie dem Baugewerbe und Berufen wie Sanitär-, Heizung, Klima werden bereits deutlich mehr Menschen ausgebildet.
Stagnierende bzw. teils rückläufige Ausbildungsangebote sind in der Region besonders kritisch, da es im Verhältnis zu den Bewerber:innen immer noch weniger Berufsbildungsstellen gibt. Dies stellt einen starken Kontrast zum Bundesdurchschnitt dar, wo rechnerisch 1,3 Berufsbildungsstellen auf eine Bewerber:in kommen. Die Unterversorgung am Ausbildungsmarkt kann als Chance für Betriebe begriffen werden, die ausbilden möchten und Menschen brauchen, die auch manuelle Arbeit verrichten wollen.
Hierbei soll der mismatch zwischen unversorgten Bewerber:innen und den Problemen der Betriebe, geeignete Kandidat:innen zu finden, keinesfalls verschwiegen werden. Dieser besteht für die Emscher-Lippe Region und laut Bildungsbericht Ruhr für das gesamte Ruhrgebiet. Vielmehr unterstreicht der mismatch die Schlüsselrolle einer attraktiven und aktivierenden beruflichen Bildung, um Menschen für die manuelle Arbeit der ökologischen Transformation zu gewinnen.
Zukunftscampus: Menschen für handwerkliche und technische Berufe gewinnen
In der Zukunftscampus Emscher-Lippe-Initiative (gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen) haben sich Berufskollegs, Kreishandwerkerschaften, Kammern, Hochschulen, die Kommunen sowie ansässige Unternehmen auf den Weg zu einer zukunftsorientierten Bildungsregion gemacht. Ziel ist es, Fachkräfte für energiewenderelevante Berufe zu sichern, die Attraktivität der beruflichen Bildung zu steigern und Menschen für technische und handwerkliche Berufe zu gewinnen.
Das entwickelte Zukunftscampus-Konzept skizziert vier komplementäre Standorte der beruflichen Bildung, an denen schulische und gegebenenfalls akademische Bildungseinrichtungen, Unternehmen und andere Organisationen kooperieren. Sie tragen zudem zur Sichtbarkeit manueller Arbeit im Stadtbild bei, unter anderem durch ansprechende Werkstätten und Lernorte.
Bildungsaufstieg: Nicht nur durch akademischen Abschluss
Didaktisches Ziel ist es, berufliche Bildung erlebbar zu machen und zu zeigen, dass beruflicher Erfolg und erfüllende Arbeit auch ohne Studium möglich sind. Denn gerade im Ruhrgebiet wird Bildungsaufstieg noch sehr oft mit einem akademischen Abschluss verbunden. Berufe wie der neu eingerichtete „Mechatroniker:in mit Differenzierungsschwerpunkt Wasserstoff“ vermitteln Grundlagen für ein Berufsleben in der Wasserstoffwirtschaft. In der Sanitär-, Heizung-, Klimaausbildung soll in Zusammenarbeit zwischen Berufskollegs, Kreishandwerkerschaft und Innungen die Lehre zu nachhaltigen Heizsystemen didaktisch noch ansprechender gestaltet werden.
Beim Zukunftscampus geht es keinesfalls darum, Studium und Berufsbildung gegeneinander auszuspielen, sondern zu zeigen, wie das Zusammenspiel für die Transformation notwendig und möglich ist. Dies wird in dem, mit dem Zukunftscampus assoziierten H2PopUpLab demonstriert. Dabei wird auch der didaktische Ansatz des Zukunftscampus erprobt, Berufe durch praktisches Ausprobieren niedrigschwellig erlebbar zu machen.
Das H2PopUpLab wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des „Wissenschaftsjahres 2025 – Zukunftsenergie“ gefördert und richtet ein Wasserstoff-Lern- und Mitmachlabor in der Gelsenkirchener Innenstadt ein. Im Spätsommer 2025 wird es seine Türen für mehrere Monate öffnen und aus einem Experimentierlabor sowie einem Veranstaltungs-, Ausstellungs- und Co-Working-Bereich bestehen. Das Lab will insbesondere jene Menschen mit Forschungs- und Energiewendethemen erreichen, die durch gewöhnliche Formate der Wissenschaftskommunikation und Berufsorientierung nicht erreicht werden.
Potenziale in Sturkturwandelregionen
Mit diesem Meinungsbeitrag hoffen wir, zu einer dreifachen Perspektiverweiterung beizutragen, die manuelle Arbeit, materielle Produktion und gegenwärtig noch fossil geprägte Strukturwandelregionen als Potenziale für die ökologische Transformation begreift. Berufliche Bildung kann hierbei ein Schlüssel zur Inwertsetzung dieser Potenziale sein. Es gilt, gemeinsam innovative Formate in der Region zu erproben, um Menschen für manuelle Arbeit und Nachhaltigkeit zu gewinnen.
Eine Herausforderung stellen die hohen Lohnkosten, insbesondere die hohen Lohnnebenkosten, dar, die eine ökologisch und sozial sinnvolle Produktion in der Region erschweren. Gerade in Regionen, die noch immer von fehlenden Ausbildungsplätzen und hoher Arbeitslosigkeit geprägt sind, könnten Bildungsträger und außerbetriebliche Ausbildungsstätten zu Innovationslaboren werden, in denen ökologisch sinnvolle Produktion vor Ort erprobt wird.
Weitere Informationen zum Zukunftscampus Emscher-Lippe finden Sie hier.
Weitere Beiträge zum Thema auf unserem Blog
Arbeitsmarkt: Die ökologische Transformation der Beschäftigung schreitet voran von Prof. Dr. Ronald Bachmann und Dr. Christina Vonnahme, RWI, Dr. Markus Janser und IAB
Wie eine Kohleregion durch Kulturarbeit grün wurde von Dr. Julia Plessing, Deutsch-Französisches Zukunftswerk
Wie unternehmerische Verantwortung auf Mitarbeitende wirkt von









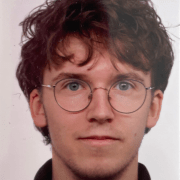
Kommentar verfassen